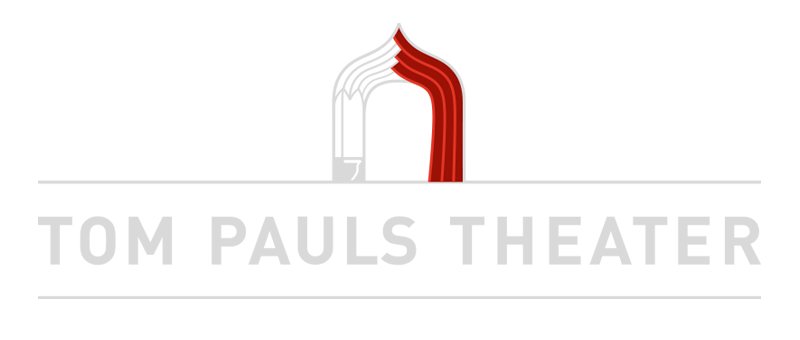Christian Ruf rezensiert in den Dresdner Neuesten Nachrichten am 23. März 2024 das neue Tom Pauls Stück, das vor Kurzem Premiere feierte.
Ein Außenseiter geht seinen Weg –
Im Pirnaer Tom Pauls Theater wird das Märchen »Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen« neu erzählt.
Von Christian Ruf
Geister, Irrlichter und Untote aller Art würden in der Geschichte auftauchen, die er zu erzählen gedenke, warnte Tom Pauls all jene, die gekommen waren, um bei der Premiere des Stücks »Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen« im Tom Pauls Theater in Pirna dabei zu sein. Insofern sei auch an dieser Stelle noch eine weitere Triggerwarnung gestattet: Pauls ist so frei, nur hier und da, und wenn, dann unterschwellig, den lustigen Bühnenclown zu geben, wie man ihn sonst kennt (und als solchen liebt).
Stattdessen schlägt der Mime in das dieser das Märchen der Brüder Grimm bewusst »neu erzählenden« Version von Mario Süßenguth vergleichsweise ernste Töne an. Da in diesem Jahr der 250. Geburtstag Caspar David Friedrich ansteht, gehen Tom Pauls und das Freddie-Ommitzsch-Studio-Ensemble dem romantischen Lebensgefühl nach und setzen wie einst Friedrich bei seinen Bildern auf stimmungsvolle Lichtverhältnisse und auch sonst viel Atmosphäre, was das »Erzählen« des Märchens angeht.
Die Anführungszeichen sind deshalb an dieser Stelle gesetzt, weil durchaus mehr passiert als reines Erzählen. Tom Pauls schildert schon viel, spielt aber (das Buch, das er in Händen hält, ist mehr Staffage als Stütze) auch sämtliche Rollen. Wandlungsfähig ist er, auch stimmlich. Den Vater, dessen zweiter Sohn nicht gerade der Klügste zu sein scheint, lässt er beispielsweise tiefstes, schönstes Ostpreußisch sprechen, also einen Dialekt, der nahezu verschwunden ist, der nur noch im familiären Umfeld der vertriebenen »Erlebnisgeneration« und auf »Heimattreffen« der Ostpreußen zu hören ist. Dieser Vater hat also zwei Söhne, der ältere ist klug und furchtsam, der jüngere furchtlos und dumm.
»Dumm« deshalb, weil ihm das Gefühl der Angst fremd ist. Und genau deshalb ist er der Außenseiter. Dass ihm auch nachgesagt wird, grausam gegen Tiere zu sein, macht die Sache nicht besser. Wer vor nichts Angst hat, dem fehlt es, modern gesprochen, an Identität, wobei die Verweigerung, sich ins Raster einzupassen, ihn andererseits auch uneinnehmbar macht. Die Überwindung der Angst, und zwar der des Daseins, das ist es, was den Kern dieses Märchens der Brüder Grimm ausmacht. Der Sohn zweifelt durchaus selbst ob seiner »Nichtnormalität«, sein notorisches Eigengejammer »Wenn’s mir doch nur gruselte« zieht sich wie ein Leitmotiv durch die Geschichte, die durchaus ein kleines bisschen mit unserer Angstlust spielt, der kleinen Schwester der Furcht.

Kleine Zeitbezüge wurden behutsam mit hinein geschmuggelt, jeder kann sich seinen Reim auf Sätze wie »Die Jugend will stets mit Gewalt in allen Dingen glücklich sein« machen, da ist gar nicht viel an Zwischen-den-Zeilen-Lesen nötig. Der »Taugenichts« von Sohn, der bei genauer Betrachtung der wohl einzig Aufrichtige in einer Welt von Heuchlern ist, wird nach einem gescheiterten »Bekehrungsversuch« auf dem Dorffriedhof jedenfalls vom genervten Vater mit 50 Talern in die Welt geschickt, auf dass er das Fürchten gefälligst lerne. Ja, »wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er….« – das erst in Männerchor-Manier a cappella und dann behutsam mit Klavier- und Gitarrentönen unterlegte Lied mit der Melodie von Friedrich Theodor Fröhlich und dem Text Joseph von Eichendorffs passt an dieser Stelle vortrefflich.
Überhaupt setzt die beeindruckende Inszenierung von Irina Pauls nicht zu knapp auf Liedgut aus der Romantik, als da wären »In einem kühlen Grunde« und »Wenn alle Brünnlein fließen«. Hinzu kommen Kompositionen von Konstantin Pauls, die oft sphärische Klang-Collagen sind und wie die grandiosen Lichteffekte das Magische und Mystische, das Übernatürliche und Wunderbare in den schaurigen Szenen unterstreichen. Da wäre die Nacht unterm Galgenbaum – allein, der Sohn sieht keinen Anlass, sich zu fürchten, mögen auch die Gehenkten im Wind baumeln. In einem Anfall von grotesk guter Absicht versammelt er die Leichen neben sich am Feuer, damit sie sich wärmen. Am Ende heißt es »Über allen Gipfeln ist Ruh’«, womit eine Prise Goethe eingestreut wird in die Geschichte.
Goethe? Ausgerechnet Goethe, der mal erklärte, ,,Klassik ist Gesundheit, Romantik ist Krankheit«? Nun, warum nicht? Die »Über allen Gipfeln ist Ruh’«-Sentenz passt – und mitnichten wie die Faust aufs Auge. Unser furchtloser Held, der mit Drehbank und Schnitzmesser ausgezeichnet umzugehen und so Totenköpfe und Geisterkatzen zur Raison zu bringen vermag, landet schließlich und endlich jedenfalls in einem verwunschenen Schloss. Drei Nächte muss er darin verbringen, dann ist des Königs holdes Töchterlein sein.
Alle Geschütze werden aufgefahren – würde man erzählen, was der Sohn hört und sieht in diesen Nächten, man würde zum Psychologen geschickt, der umgehend viele Tests mit einem macht. Einmal hüpfen und tanzen gar vier schwarze Mönchskuttenträger zu E-Beats, auch das ein Bild, das einfach nur fasziniert in seiner Stimmigkeit. Überhaupt ist zu konstatieren, dass man als Zuschauer höchst entzückt von Einfallsreichtum, mit dem diese Inszenierung, die durchaus auch als kleine, aber feine Parodie auf gängige Romantik(er)fantasien erachtet werden kann, aufwartet.
Im Original der Brüder Grimm ereilt den Sohn der Schrecken schließlich in der Hochzeitsnacht, was ein Leckerbissen für alle Freudianer ist, wie schon der Dresdner Dichter Durs Grünbein 2005 erkannte. In dieser Adaption durch den Autor Mario Süßenguth lernt er das Gruseln beim Auftritt eines Schlagersängers, der in Dresden seit Jahren im Sommer bei den Filmnächten am Elbufer eine regelrechte Woge der Begeisterung auslöst.
Die Schlusspointe ist ein bisschen billig, aber zu sehen, wie Pauls mit Perücke und Glitzersakko als Schlagersänger durch die Kulissen geistert, ist ein Anblick, den man so schnell nicht vergisst.